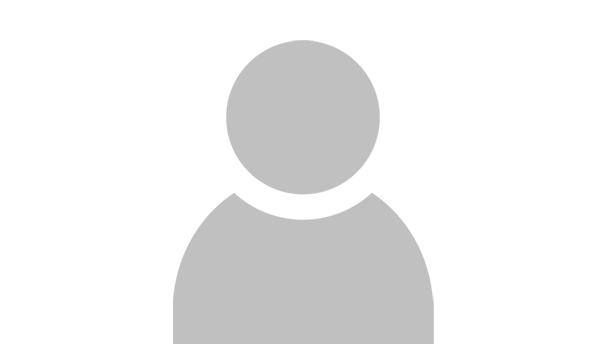Wer das Hochhaus des FHNW Campus Muttenz betritt, ist beim ersten Mal sprachlos: Ein Atrium dehnt sich über drei Etagen. Treppen schweben, streben ins Licht. Neunzig Prozent der Besucher, schätzt Raymond Weisskopf, kämen anfangs aus dem Staunen nicht heraus. «Mir ist es damals genauso ergangen», erinnert er sich an sein erstes Mal. «Und heute staune ich immer noch.»
Die Fachhochschule Nordwestschweiz ist ein visionäres Projekt, nicht nur wegen des Baustils. Raymond Weisskopf aus «Ütige» gehört seit neunzehn Jahren zu demjenigen Team, das dieses Projekt möglich machte. Seine Funktion: Vizepräsident der Fachhochschule und Leiter Services; er «verwaltet» einen Etat von 490 Millionen Franken im Jahr.
An diesem Frühlingstag 2021 sitzt Raymond Weisskopf in seinem Büro im vierten Stock. An der Wand: Porträts von vier Weisskopf-Seeadlern. Grosse Fenster lassen viel Landschaft in den Raum. Der Blick geht weit. Am Horizont kämmt ein Wald die Wolken.
Wie hat für ihn alles begonnen? Raymond Weisskopfs Augen wandern in die Ferne, er lächelt. «Im öffentlichen Bereich arbeiten – das konnte ich mir nie vor-stellen. Als Betriebsökonom wollte ich nicht täglich Verluste managen, sondern in der Wirtschaft was bewegen.» Und das hat er getan, als Finanzchef bei namhaften KMU. «2002 meldete ich mich aus Neugier auf ein Jobinserat. Zehn Minuten las ich das Dossier. Dann machte es klick, und ich bewarb mich.» Am
1. Juli 2002 begann er bei der Fachhochschule beider Basel als Vorsteher eines Departements. «Ich bekam eine tolle Arbeitgeberin in einer wunderbaren Branche, im Bildungsbereich. Was gibt es Schöneres in der Schweiz?»
«Die Regierungsräte entschieden sich für die Fusion der Fachhochschulen zur FHNW. Damit gingen sie durchaus ein Risiko ein. »
Damals, vor neunzehn Jahren, geriet Raymond Weisskopf mitten hinein in ein gigantisches Fusionsvorhaben. Als Projektleiter Administration spielte er sogar eine tragende Rolle, er hat das Konzept mitentwickelt. «Ich trage die Erinnerung an die Anfänge der FHNW in meinem Herzen. Es war wie ein Baby, das ich beim Grosswerden begleitet habe.»
Ein Rückblick: Im Jahr 2003 fasste das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie einen wegweisenden Beschluss. Die Bildungslandschaft der Schweiz sei neu zu gestalten. Am Ende, so der Plan, würde es nur noch sieben vom Bund geförderte Fachhochschulen geben. Wenig später geschah Überraschendes. Die Regierungsräte der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau und Solothurn setzten sich über den Kantönligeist hinweg. Sie entschieden: Die Fachhochschulen der Kantone fusionieren. Zur FHNW.
Das war ein mutiger Schritt, meint Raymond Weisskopf. «Die Regierungsräte wollten ja wiedergewählt werden. Mit ihrer Entscheidung gingen sie durchaus ein Risiko ein. Sie mussten sich auch bei den Finanzen aus dem Fenster lehnen, mussten Gelder in den Kantonen auf Jahre hinaus binden.»
«Wir brauchten Mut zur Lücke. Denn wir betraten Neuland.»
Die Kantone waren mit den Vorstellungen des Projektteams stark gefordert. Manchmal, Raymond Weisskopf ist sich sicher, waren diese Wünsche am Rande des Zumutbaren. «Wir wollten eine Fachhochschule mit einer kraftvollen Corporate Identity, eine starke Marke auf dem Bildungsmarkt Schweiz. Zugleich sollten die einzelnen Hochschulen aber grösstmögliche Autonomie in Forschung und Lehre bekommen.»
2004 war der Staatsvertrag unterzeichnet; 2006 wurde die FHNW offiziell gegründet. Die Denker und Planer hatten weiterhin hohe Ansprüche: Alle Stand-orte sollten verkehrsgünstig liegen, alle Neubauten modernste Bedingungen bieten. «Wir brauchten damals Mut zur Lücke», erinnert sich Raymond Weisskopf. «Denn wir betraten Neuland, wir mussten einen Schritt nach dem anderen gehen.» Ein Kraftakt. «Heute können wir mit Stolz und Demut sagen: Er ist uns gelungen.»
«In der FHNW herrschte Aufbruchstimmung von Anfang an. Die Architektur symbolisiert diesen Aufbruch. »
Auch sie war früh am Projekt beteiligt: Anja Huovinen. Sie hat Spanisch und Geschichte studiert, dann übernahm sie eine Managementfunktion an der Universität beider Basel. Als die Fusion begann, war sie bei der Bildungsdirektion des Kantons Basel-Landschaft zuständig für Hochschulprojekte. «Aber seit 2014», sagt sie lächelnd, «bin ich begeisterte Mitarbeiterin der FHNW.» Heute ist sie die persönliche Referentin des Direktionspräsidenten.
Beim Videogespräch an diesem Frühlingstag sitzt sie im Homeoffice in Basel, vor dem Fenster liegt ein kleiner, stiller Hof mit einer Birke. Sie wäre gern schnell wieder vor Ort, in den Hochschulen. Schon wegen der spektakulären Bauform.
Im Projekt FHNW herrschte Aufbruchsstimmung von Anfang an. Die Architektur symbolisiert diesen Auf-bruch an allen Campuseinheiten – in Muttenz, Olten, Solothurn, in Dreispitz Münchenstein und Brugg Windisch. Die Trägerkantone haben viel Geld für neue Bauten gegeben: fast eine Milliarde Franken. Anja Huovinen sass in der Planungskommission von Muttenz. Das Hochhaus war ein Jahr früher fertig als vorgesehen. Und man blieb sogar unter den geplanten Kosten von 300 Millionen.

«Die Räume der Studierenden sind mit der besten Aussicht. 360 Grad Rundblick. Bis in den Schwarzwald!»
Alle Neubauten wurden auf die Bedürfnisse der Fachbereiche hin konzipiert. «Die Architektur rückt die Studierenden in den Mittelpunkt», so beschreibt es Anja Huovinen. «Ihre Räume sind die mit der besten Aussicht. 360 Grad Rundblick, bis in den Schwarzwald und die Vogesen!» Offene Horizonte ohne Grenzen – ja, genau das bietet die Hochschule. Die Gebäude haben Höhe und Weite. Sie sind eine Einladung zum Denken. Und Sinnbild dessen, was die Bildung den Studierenden bringt.
Bevor die Hochschulen fusionierten, hatten sie gut hundert Standortadressen. Heute sind es noch acht. Und jedes Gebäude, betont Anja Huovinen, hat einen eigenen Charakter. Was ihr besonders gefällt? In Brugg Windisch sind es die Arbeitsplätze auf breiten Fluren, sehr hell, die Studierenden lieben sie. «In Muttenz mag ich die wunderbar nordisch anmutende Innenarchitektur. Helles Holz, dunkle Flächen, Beton, die bunten Farbtupfer der Möbel. Warm und funktional.»
Im Campus Dreispitz in Münchenstein wiederum wurden die Gebäude des alten Zollfreilagers transformiert. Dazu kamen ein Hochhaus und ein Campusplatz, der wirklich lebt. Die Cafeterias sind öffentlich, wie an allen Campusstandorten. Die Hochschule öffnet sich in den Ort hinein, viele Menschen kommen. Ganz anders als früher.
«Die Vielfalt. Das Internationale. Und die Praxisnähe. All das begeistert an der FHNW.»
Die FHNW im Jahr 2021, das sind neun Hochschulen mit mehr als 13 000 Studierenden. Damit ist sie die drittgrösste Fachhochschule der Schweiz. «Wir haben in den Bachelorstudiengängen mehr Erstsemester als die Uni Basel», erwähnt Anja Huovinen. «Was mich an der FHNW begeistert? Die Vielfalt. Das Interdisziplinäre. Das Internationale. Und ihre Praxisnähe. Unsere Forschenden und Studierenden helfen den Unternehmen und Institutionen in der Region, Probleme und Fragestellungen zu lösen.»
Raymond Weisskopf: «Uns war seit Beginn klar: Wenn wir die neue Fachhochschule in der Region verankern wollen, muss die Wirtschaft sie als Partnerin begreifen.» Vom Überbau, von der Leitung der FHNW bekämen die einzelnen Hochschulen alles, was sie für ihre Aufgaben brauchen. «Wir wollen etwas ermöglichen, nicht reglementieren.»
Mitarbeitende und Studierende aus den Fachbereichen Informatik, Technik, Musik und Angewandte Psycho-logie würden zum Beispiel gemeinsam Apps und Computerspiele für betagte Menschen in Alters- und Pflegeheimen entwickeln. Diese Spiele, sagt Anja Huovinen, regen zum Erzählen an, weil sie persönliche Bilder und Töne aus dem Leben der Menschen integrieren. «Andere tüfteln mit Hingabe an sozialen Robotern. Die können in Pflegezentren und Bibliotheken zum Einsatz kommen.»
Die FHNW ist ein Platz steter Erneuerung, ein Ort der Innovation, und Anja Huovinen gibt der Innovation gerade wieder einen Schub. Sie leitet das Projekt «Hochschullehre 2025»; sie sorgt mit dafür, dass die FHNW die Hürden der Digitalisierung in der Lehre meistert. «Andere denken vielleicht zuerst an Technik. Wir denken daran, wie wir die Energie und das geballte Wissen unserer eigenen Leute zum Vorteil aller einsetzen können.» Peer Learning sei für die Dozierenden das Gebot der Stunde: voneinander lernen, auf Augenhöhe. «Wir überlegen: Wie können wir die Studierenden heute für die Jobs von morgen ausbilden?»
«Wo versichern wir unsere Mitarbeitenden? Wie etablieren wir ein attraktives Vorsorgewerk? »
Die FHNW ist ein Magnet. Er zieht kluge Köpfe in die Nordwestschweiz, Mitarbeitende und Dozierende. Die Fachhochschule will sie natürlich halten. «Das stellt hohe Anforderungen an uns als Arbeitgeberin», sagt Raymond Weisskopf. «Auch bei der Altersvorsorge.» Wo versichern wir unsere Mitarbeitenden? Wie etablieren wir ein attraktives Vorsorgewerk? Das waren am Anfang drängende Fragen.
Die Entscheidung fiel für die blpk – weil sie die Anforderungen der FHNW exzellent erfüllte und viele Mitarbeitende dort bereits versichert waren. Dazu kam: Die Kasse ist eine Sammeleinrichtung. «Wir wirtschaften also auf eigene Rechnung», so Raymond Weisskopf. «Und wir haben für unsere Versicherten im Rahmen des Möglichen gute Bedingungen.»
Die FHNW ist einer der grössten Kunden der blpk. Er sei mit dem Service sehr zufrieden, betont Vizepräsident Raymond Weisskopf. «Wir werden gut betreut, haben einen direkten Draht. Die Kasse performt überdurchschnittlich, und sie achtet auf Nachhaltigkeit.»

Wie sieht Raymond Weisskopf das Vorsorgesystem der Schweiz insgesamt? «Im Vergleich mit anderen Staaten stehen wir gut da.» Die Altersverteilung mache ihm allerdings Sorgen. Sie schätze das System ebenfalls, ergänzt Anja Huovinen. «Stabilität und Solidarität sind mir wichtig. Die Versicherten tragen einen grossen Teil der Verantwortung selbst, doch der Staat sorgt für einen guten Kompromiss.» Eine Eigenheit des Vorsorgesystems sei typisch Schweiz, glaubt Anja Huovinen: «Stabilität, das heisst bei uns eben nicht Starrheit und Bürokratie, sondern Entwicklung und Effizienz.»
«Wie gelingt eine glückliche Transformation? Mit Führung und Freiraum. »
«Fachhochschule Nordwestschweiz», das ist längst ein Name mit Klang. Auch weil die Hochschule sich immer wieder neu erfindet. Manche Erfahrungen des Teams könnten anderen Unternehmen und Institutionen gut als Beispiel dienen. Etwa die Lehren aus dem Jahrhundertprojekt «Fusion» oder jetzt die Erkenntnisse vom digitalen Wandel.
Herr Weisskopf, Frau Huovinen, was braucht es für eine glückliche Transformation? Eine Vision, natürlich. Ein starkes Netzwerk. Dazu Mut – mutige Vordenkerinnen, Vordenker und motivierte Mitarbeitende. Es brauche vor allem die richtige Balance zwischen Führung und Freiraum. «Man muss gut zuhören, dann aber auch entscheiden», sagt Raymond Weisskopf. «Und man muss den Leuten ein Gefühl geben. Das Gefühl: Hier geht was!»
Die FHNW - Zahlen und Fakten
9
Hochschulen: Angewandte Psychologie; Architektur, Bau und Geomatik; Gestaltung und Kunst; Life Sciences; Musik; Pädagogik; Soziale Arbeit; Technik; Wirtschaft
8
Adressen an 5 Standorten: Muttenz, Brugg Windisch, Basel, Solothurn und Olten
29
Bachelorstudiengänge mit 10'800 Studierenden
18
Materstudiengänge mit über 2'300 Studierenden
3'200
Mitarbeitende
1'300
Projekte mit Praxispartnern