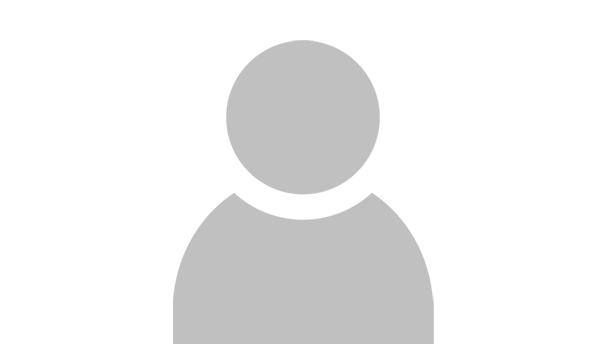Hermann Kinkelin (1832–1913), Professor für Mathematik an der Universität Basel, gehörte um 1900 zu den führenden Versicherungsexperten der Schweiz. Sein Fachgebiet waren die sogenannten Alterskassen, die Vorläufer der heutigen Pensionskassen. Diese Alterskassen waren kleine und mittelgrosse Versicherungen, die sich seit den 1860er-Jahren in der ganzen Schweiz ausgebreitet hatten. Sie gewährten älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Leistungen, um sie vor Armut zu schützen.
Professor Kinkelin war ein viel gefragter Berater verschiedener Behörden. Mit seinem versicherungstechnischen Wissen unterstützte er verschiedene Städte und Kantone bei der Einrichtung von Beamtenkassen für Staatsangestellte. Diese Kassen zahlten hohe Renten, teilweise über fünfzig Prozent des vormaligen Gehalts.
Häufige Konkurse
Neben den Beamtenkassen gab es Kassen für handwerkliche und gewerbliche Berufe. Dazu kamen Kleinstkassen («Wohlfahrtseinrichtungen»), mit denen einzelne Arbeitgeber ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen versicherten. Die Renten entsprachen oft nur zwanzig Prozent des früheren Lohnniveaus. Und wechselte eine versicherte Person den Arbeitgeber, verlor sie meist alle Einlagen. Bei kleineren Alterskassen waren Konkurse häufig.
Kinkelin war ein lautstarker Kritiker solcher Kleinstkassen. Am schärfsten verurteilte er die sogenannten «Frankenvereine», eine verbreitete Form von Sterbekassen. Beim Tod eines Versicherten zahlten die überlebenden Vereinsmitglieder je einen Franken an die Hinterbliebenen. Mit fortschreitendem Alter – der Kassen wie auch ihrer Mitglieder – sank jedoch die Attraktivität für Einsteiger. Die meisten Frankenvereine endeten im Ruin.
Erster Weltkrieg - ein Wendepunkt
Der Erste Weltkrieg war ein Wendepunkt in der Geschichte der Pensionskassen. Bundesrat und Parlament entschieden 1916, die Wohlfahrtseinrichtungen von Unternehmen steuerlich zu fördern. Damit wollte man Arbeiter und Arbeiterinnen vor Notlagen schützen.
Das Gesetz sollte aber auch die Unternehmer entlasten, als Ausgleich für die gleichzeitig eingeführte Kriegsgewinnsteuer. Arbeitgeber konnten Gewinne fortan also steuerbefreit in die Vorsorge für ihre Belegschaft investieren. Dafür gab es zwei Bedingungen: Die Kassen mussten technische Minimalstandards erfüllen und die Versicherten wurden in die Verwaltung einbezogen.
Noch während des Kriegs gründeten Hunderte von Unternehmen eigene Pensionskassen. Sie wollten soziale Spannungen vermeiden, das Personal an die Firma binden und Kriegsgewinne vor dem Fiskus retten. Nach dem Krieg setzte sich der Gründungsboom fort. Zum Vergleich: 1903 kannte die Schweiz rund 100 Kassen; 1941 waren es über 4000. Zu den Neugründungen zählte die Basellandschaftliche Pensionskasse (1921).
«Staatssozialismus»
In der Zwischenkriegszeit entdeckten auch die kommerziellen Versicherungsgesellschaften das neue Geschäft. Sie lancierten erfolgreich Angebote für Gruppenversicherungen, in denen Unternehmen ihre Belegschaft kollektiv versichern konnten.
Schweizer Behörden und Politiker diskutierten ausserdem seit dem Ersten Weltkrieg intensiv über eine staatliche Altersvorsorge. Im Landesstreik von 1918 gehörte die Einführung der AHV zu den obersten Forderungen der Streikbewegung.
1931 wurde erstmals über ein AHV-Gesetz abgestimmt. Es sah eine bescheidene AHV als Parallelversicherung neben den Pensionskassen vor. Doch dieser erste Anlauf scheiterte am Widerstand der Pensionskassen. Die Vereinigung der Beamtenkassen sah in der AHV eine ungewollte Konkurrenz, sprach von drohendem «Staatssozialismus» und führte eine scharfe Gegenkampagne. Die Vorlage wurde mit über sechzig Prozent Neinstimmen klar abgelehnt.
Die zweite Gründungswelle
Im Zweiten Weltkrieg gab es eine weitere Welle von Pensionskassengründungen. Alleine 1942 und 1943 wurden je 850 Kassen gegründet. Parallel dazu kündigte 1944 Bundespräsident Walther Stampfli in seiner Neujahrsansprache die Einrichtung einer Alters- und Hinterlassenenversicherung an. Fünf Jahre später, 1949, wurde sie gegründet.
In erster Linie waren das Beamte sowie Angestellte der Staatsbetriebe (SBB und Post), aber auch die Industriearbeiterschaft und die Angestellten grosser Dienstleistungs-unternehmen. Ihre Altersrente von Pensionskassen und AHV sicherte ihnen in der Regel mehr als die Hälfte des vormaligen Einkommens.
Ungeliebter Zweig des Sozialstaats
Die Anzahl der Versicherten hat in beiden Säulen seit dem Krieg stark zugenommen. Zwischen 1941 und 1966 verdoppelte sich diese Zahl im öffentlichen Sektor – von 120 000 auf 241 000. Im privaten Sektor stieg sie gar auf das Siebenfache: von 163 000 auf 1,1 Millionen. Der Anteil der Versicherten an der Gesamtzahl der unselbstständig Erwerbstätigen betrug am Ende des Zweiten Weltkriegs rund zwanzig Prozent. Mitte der 1950er-Jahre lag er bei über einem Viertel, Mitte der 1960er bei rund fünfzig Prozent.
Die AHV blieb bis in die 1960er-Jahre ein ungeliebter Zweig des schweizerischen Sozialstaats. Und noch in den 1970er-Jahren lag das Niveau der AHV-Mindestrenten klar unter dem der Sozialhilfe. Die staatlichen Renten waren nicht existenzsichernd; die verbreitete Altersarmut konnten sie nicht beseitigen. Die AHV wurde ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht.
AHV und berufliche Vorsorge zusammen sollten allen Versicherten die «gewohnte Lebenshaltung» gewähren.
Drei-Säulen-System gewinnt Kontur
In anderen Ländern Europas wurde das staatliche Rentensystem nach dem Krieg zum zentralen Pfeiler der Altersvorsorge, etwa in Deutschland, Frankreich, Italien und in den skandinavischen Staaten. In der Schweiz hingegen schärften sich in den Sechzigern die Konturen eines Mehrsäulen-systems. Ausgangspunkt der Debatten waren Vorstösse linker Parteien. Die Sozialdemokratische Partei und die kommunistische «Partei der Arbeit» (PdA) lancierten je eine Verfassungsinitiative. Beide forderten unter dem Begriff der «Volkspension» eine deutlich gestärkte AHV, die PdA darüber hinaus die Verstaatlichung der Pensionskassen.
Bürgerliche Kreise lancierten eine dritte Initiative: Neben der AHV sollte die berufliche Vorsorge obligatorisch werden; Selbstvorsorge sei steuerlich zu fördern. Im Parlament einigten sich bürgerliche Parteien und SP auf einen Gegenvorschlag zur PdA-Initiative, der diesem Modell folgte. Das Ziel: AHV und berufliche Vorsorge zusammen sollten allen Versicher-ten die «gewohnte Lebenshaltung» gewähren, das heisst rund sechzig Prozent des Erwerbseinkommens sichern. Dieser Gegenvorschlag wurde mit 77 Prozent Jastimmen klar angenommen; die PdA-Initiative scheiterte bei über 80 Prozent Neinstimmen.
Der bürgerliche Rotstift
1972 wurde das Drei-Säulen-Prinzip in der Bundesverfassung verankert. Jetzt mussten Gesetze folgen. Doch die Umsetzung des Verfassungsauftrags verlief ernüchternd. 1974/1975 gab es eine Rezession. Im Nachgang fielen Teile des Kompromisspakets dem bürgerlichen Rotstift zum Opfer. Die Parlamentsmehrheit kippte das in der Verfassung formulierte Leistungsversprechen aus dem Gesetz. Sechzig Prozent des Erwerbseinkommens als Rente: Das galt nicht mehr.
1985 wurde das Gesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) verabschiedet – jedoch ohne Festlegung einer Mindesthöhe für Rentenleistungen. Zudem wurde die zweite Säule nur ab einer bestimmten Einkommensschwelle für obligatorisch erklärt. Niedrigverdienende und Teilzeitbeschäftigte, mehrheitlich Frauen, waren in der zweiten Säule schlecht oder gar nicht versichert.
100000 Versicherte mehr
Seit damals gibt es Debatten um die weitere Entwicklung der zweiten Säule. Im Zentrum steht häufig die Frage: Soll die Versicherungspflicht ausgeweitet werden? 2005 kam eine erste BVG-Revision. Sie setzte die Eintrittsschwelle in der beruflichen Vorsorge deutlich herab. Dadurch konnten rund 100 000 zusätzliche Personen, in der Mehrheit Frauen, in die Versicherung aufgenommen werden. Weitere Schritte in diese Richtung diskutiert man auch in den aktuellen Reformdebatten
Der älteren Bevölkerung sei die Fortsetzung der «gewohnten Lebenshaltung» zu ermöglichen, so steht es im Verfassungsauftrag. Bis zur Einlösung dieses Auftrags ist es allerdings noch ein weiter Weg.