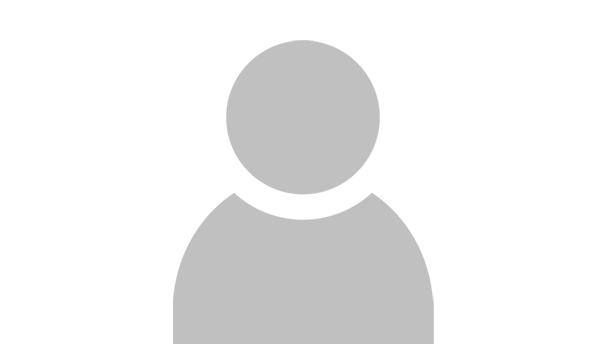Sie provoziert. Sie polarisiert. Sie bringt die Probleme der Vorsorge auf den Punkt – Veronica Weisser. Im Videogespräch verrät die Ökonomin: Was können wir von Südafrikas Stämmen lernen? Wie lässt sich die Krise der zweiten Säule überwinden? Ist die blpk eigentlich auf Kurs? Und: Wie kommen auch Frauen zu einer guten Rente?
Frau Weisser, wo sind Sie gerade?
Ich sitze im Kinderzimmer zu Hause. Hier habe ich Sonnenlicht und den schönsten Blick – aufs Dorf und sogar auf den Zürisee. Home-office ist für mich eine gute Alternative, weil ich mehr Zeit für meine Buben habe. Und ich brauche nur drei Sekunden ins Büro.
Sie sind in Südafrika aufgewachsen, während der Apartheid. Was haben Sie an Erfahrungen mitgenommen nach Europa?
Zum einen: Der Wohlstand, den wir in Europa kennen, ist nicht selbstverständlich. Ich habe viel Armut gesehen, und wir selbst lebten einfach. In Europa würde man sagen: unterer Mittelstand, doch in Südafrika fühlte ich mich wohlhabend. Zum anderen: In Afrika muss man wirklich bereit sein zu kämpfen, viel zu leisten, wenn man halbwegs über die Runden kommen will.
Europa - war das ein Kulturschock für Sie?
Ich bin mit fünfzehn als Austauschschülerin in Augsburg gewesen. Ein Schock war, als ich erlebte, wie viele Leute Deutsch sprechen. Ich wusste das natürlich. Aber es zu erleben, war etwas anderes. Ausserhalb meiner Schule in Pretoria sprach niemand Deutsch!
Als ich später nach Deutschland zog, hatte ich das Gefühl: Hier herrscht eine Monokultur, zumindest eine stark dominierende Kultur. Das hat mich irritiert. Südafrika wirkt wie ein kleiner Kontinent mit seinen zwölf, dreizehn Stammesgruppen. Dazu die vielen Menschen mit europäischen Wurzeln und viele Asiaten. Hier hingegen ist alles recht einheitlich. Das macht das Zusammenleben natürlich einfacher, manchmal aber auch weniger spannend.
Wie gehen die Generationen dort miteinander um, in den schwarzen Kulturen Südafrikas?
Die Alten werden verehrt, denn sie bilden die Brücke zu den Ahnen, den Geistern. Die Verbindung zu den Ahnen ist eng, man glaubt, dass sie den Alltag beeinflussen. Die Alten führen die Zeremonien, sie führen den Stamm. Sie werden deshalb gut behandelt.
In einigen Traditionen verbeugen sich die Kinder vor den Erwachsenen und die Erwachsenen vor den Alten. Mehr noch: Man legt sich mit gefalteten Händen auf den Boden. Frauen müssen sich aber auch vor den Männern verbeugen und die Mädchen vor den Jungs. Hier gibt es also Unterdrückung, zumindest nach europäischen Werten.
Was bedeutet «Altersvorsorge» in Südafrika?
Es gibt eine minimale staatliche Grundabsicherung, die reicht jedoch nicht mal fürs Essen. Menschen mit Einkommen versichern sich privat, oder man hat Kinder, ganz viele Kinder.
Wechseln wir in die Schweiz: Unsere Altersvorsorge steckt in der Krise. Warum?
Wir haben die drei Säulen, eigentlich ein sehr gutes System. Aber: In der ersten Säule versprechen wir uns Renten von Nachkommen, die wir nicht haben. In der zweiten Säule beziehen wir Renten von Kapital, das wir nicht besitzen. Und die dritte Säule nutzen viele nicht, weil sie freiwillig ist.
«In der zweiten Säule haben wir zu viel versprochen»
Das System sei gegenüber den Jungen nicht gerecht, beklagen Experten. Was haben unsere Kinder und Enkel zu erwarten, wenn wir so weitermachen wie bisher?
Eine viel höhere Belastung. Die Babyboomer haben ja wenig Kinder. Der Umkehrschluss ist, dass diese wenigen Kinder viele Eltern haben. Und diese vielen Eltern beziehen auch viel länger Rente. In der zweiten Säule haben wir also zu hohe Renten versprochen. Um sie zu finanzieren, nutzt man heute die Renditen der Erwerbstätigen. Wenn die dann ins Pensionsalter kommen, werden sie staunen, wie tief ihre Renten ausfallen.
Wir haben in einer Beispielrechnung die Renten von zwei identischen Personen berechnet. Diese «Zwillinge» haben dieselbe Ausbildung, den gleichen Beruf und die gleiche Laufbahn in derselben Firma. Einziger Unter-schied: Der eine Zwilling wurde 1990 fünfzig, der andere ist heute fünfzig. Das Resultat war ernüchternd: Kauf- kraftbereinigt liegt die PK-Rente des Jüngeren um dreissig bis vierzig Prozent tiefer.
Die Erwerbstätigen werden noch auf andere Weise benachteiligt, schreiben Sie. Wie?
Erwerbstätige müssten in der Pensionskasse viel höhere Renditen bekommen als Rentner. Rentner tragen ja kein Risiko mehr, ihre Renten sind geschützt. Nur die Erwerbstätigen tragen das Anlagerisiko – auch das des Rentnerkapitals. Doch sie erhalten eine Anlagerendite, die diesem höheren Risiko überhaupt nicht entspricht.
Was wäre ein gerechtes Rentenalter?
Diese Frage muss die Gesellschaft beantworten. Was wollen wir – viel Geld, eine hohe Pension? Dann müssen wir länger arbeiten. Oder mehr freie Zeit? Dann müssten wir tieferen Wohlstand in Kauf nehmen. In Frankreich sagen sie: Freizeit, ganz klar. In der Schweiz möchten viele beides, das geht aber nicht. Ein faires Rentenalter? Aus ökonomischer Perspektive läge das heute im Durchschnitt schon bei 67.
Was wäre überhaupt «gerecht»" in der zweiten Säule?
Gerecht wäre, wenn jede Generation mit ihrem Kapital auskommt. Wenn der letzte 65-Jährige von heute stirbt, müsste der letzte Franken aus der Kasse dieser Gene-ration gerade aufgebraucht sein. Doch in Wirklichkeit leben wir deutlich länger als unser Kapital. Das heisst, die letzten Lebensjahre werden wir von den jungen Generationen finanziert.
«Was wollen wir später - viel Geld? Oder mehr freie Zeit?»
Also müssen die Renten sinken?
Absolut. Einige Pensionskassen haben die Umwandlungssätze deshalb reduziert. Ein fairer Umwandlungssatz läge heute bei 4,5, maximal 5 Prozent. Alles darüber hat eine riesige Umverteilung zur Folge.
Die blpk hat ihren Umwandlungssatz auf 5.0 Prozent gesenkt. Ist sie damit auf dem richtigen Weg?
Auf jeden Fall, ja.
Was könnte die blpk tun, um den Jungen gegenüber noch gerechter zu sein?
Ich weiss nicht, ob Sie das abdrucken möchten, aber ... Ja, man müsste mit dem Umwandlungssatz systematisch Jahr für Jahr weiter runter.

Sie gehören zu jenen Jüngeren, die jetzt von den Älteren benachteiligt werden. Müssten die Jungen nicht aufbegehren gegen das ungerechte System?
Ich mache darauf aufmerksam – indem ich viel darüber rede. Ich fühle mich aber auch mitverantwortlich. Meine Generation macht ebenfalls vieles falsch. Aus ökologischer Sicht sind wir nicht viel besser als die Babyboomer und Rentner. Ja, doch, ich sehe mich in einer Mittäter-Verantwortung.
Alle paar Jahre versuchen sich Experten an Reformen der zweiten Säule. Warum scheitern sie?
Weil es immer wieder demagogische Stimmen gibt. Die sind nicht bereit zu sagen: «Wir müssen jetzt diesen schwierigen Weg gehen.» Wären genug Politiker und Gewerkschafter ehrlich und würden sie die harte Nachricht gemeinsam überbringen, dann würde die Schweizer Bevölkerung diese harte Nachricht auch eher annehmen.
In den Familien leben die Generationen miteinander. Gerade Familien würden in der Schweiz aber benachteiligt, schreiben Sie. Woran sehen Sie das?
Zum Beispiel an Statistiken, an materieller Entbehrung. Die höchste Armutsquote haben die Kinder. Die zweit- höchste liegt bei den Eltern von jungen Kindern. Und die tiefste Armutsquote haben die Rentner. Das müsste uns zu denken geben.
«Am ärmsten sind die Kinder. Am wenigsten arm die Rentner.»
Wie kann der Staat die Familien gerechter behandeln?
Zuerst muss man verstehen: Was ist hier historisch gesehen passiert? Vor 1900 hatten die Menschen gern sechs, acht, zehn Kinder, denn Kinder waren Reichtum. Im Alter von zwölf, dreizehn waren sie volle Arbeits-kräfte, die man nicht mal bezahlen musste. Man musste ihnen überspitzt gesagt nur zu essen geben. Mit der Schulpflicht hat man den Eltern diese Arbeitskraft zum grossen Teil entzogen. Die Schule bildet die Kinder für den Staat aus, für den Arbeitsmarkt, damit sie Steuern zahlen. Die Vorteile der Kinder kommen seither allen zugute, auch den Kinderlosen. Die Nachteile sind aber bei den Familien geblieben. Deshalb sind Menschen mit Kindern in der Schweiz ärmer. Bei UBS haben wir das mal berechnet: Ein Durchschnittspaar in der Schweiz mit zwei Kindern ist bei Erreichen des Rentenalters um etwa eine Million Franken weniger vermögend als das äquivalente Paar ohne Kinder.
«Der Staat sollte Eltern höhere Pensionen zahlen. Oder die Kitas finanzieren. »
In welcher Form sollte sich der Staat also für Familien einsetzen?
Er hat zwei Optionen. Er könnte Eltern mehr Rente aus dem Umlageverfahren zahlen und Kinderlosen weniger. Die zweite Option ist für den Wohlstand der Schweiz effektiver: Der Staat sollte die Kinderbetreuung finanzieren. Dann könnten sich mehr Mütter ihre Renten auf dem Arbeitsmarkt verdienen. Der Staat bekäme mehr Steuern, es gäbe mehr Fachkräfte. Und die Kinder würden effizienter versorgt. Das muss aber jeder und jede für sich selbst entscheiden. Meine Meinung ist: Kinder können von liebevoller Drittbetreuung sehr profitieren. Ich mache gerade diese Erfahrung.
Ausserdem sollte der Staat ausreichend Mutterschaftsurlaub gewähren, später aber auch den Wiedereinstieg unterstützen. Es muss möglich sein, dass ein Kind bis um sieben betreut wird. Dann müssen Mutter oder Vater nicht schon um 16.30 Uhr den Arbeitsplatz verlassen.
Also wäre es an der Zeit, dass der Staat Kitakosten anteilig oder ganz übernimmt?
Ich glaube, das ist die beste Altersvorsorge für Frauen. Und effizient für den Staat. Ganz wichtig ist ausser- dem das Steuersystem: In der Schweiz greift bei Ver- heirateten die Progression. Wir müssten auf ein System der Individualbesteuerung wechseln.
Sie sind Expertin für Vorsorge bei der UBS: Was empfehlen Sie Privatkunden, zum Beispiel bei Vorsorge-Veranstaltungen?
Die jungen Kunden motivieren wir, zu sparen und zu investieren. Im Idealfall zehn bis fünfzehn Prozent des Lohns. Das ist relativ viel, aber so wären sie für die Altersvorsorge gut aufgestellt. Sparen heisst: Dauerauftrag! Dann müssen sie gar nicht mehr hinschauen. Sie müssten es nur tun!
«Liebe junge Frauen: Kämpfen Sie für Ihr Recht, machen Sie Karriere!»
Und welchen Rat geben Sie jungen Frauen für ihre Vorsorge?
Ich sage ihnen: Liebe Frauen, Sie haben ein Recht zu arbeiten. Kämpfen Sie für dieses Recht, machen Sie Karriere! Und wenn sie dann Kinder haben: Kommen Sie zurück in den Beruf und bald auch wieder auf ein höheres Pensum.
Unser Gespräch dreht sich ums Geld. Sie arbeiten bei UBS, einem der grössten Geldhäuser der Welt. Wie wichtig ist Geld für Sie?
Ich bin Minimalist. Geld ausgeben ist nicht mein Ding, ich gehe auch ungern shoppen. Aber Geld bedeutet: Potenzial für die Zukunft. Und in dieser Beziehung ist es mir wichtig.
Der Lebensabend ist für Sie noch weit weg, doch er kommt. Was wollen Sie dann tun?
Ich werde Fitnesstrainerin oder Reisebegleiterin. Sprich: Ich möchte sehr aktiv bleiben.
Zur Person
Dr. Veronica Weisser, Jahrgang 1979, Ökonomin und Expertin für Vorsorge bei UBS. Geboren und aufgewachsen in Pretoria, Südafrika. Muttersprache: Englisch. Ausser Deutsch spricht sie auch Afrikaans, Französisch, Spanisch. Der Vater, Botaniker, ist Chilene deutscher Abstammung, die Mutter Südafrikanerin mit britischen Wurzeln. Weisser besuchte eine deutsche Schule in Pretoria, mit neunzehn ging sie nach Europa. Studien: Mathematik und Wirtschaftswissenschaften in Hamburg und Köln, Masterstudium in Barcelona und Paris, Doktorat in Bern. Seit 2006 in der Schweiz, wohnhaft in Pfäffikon SZ. Verheiratet, zwei Kinder, vier und sechs Jahre alt.